Das „Echo des Urknalls“ brachte 2006 den Physik-Nobelpreis
den beiden US-Physikern John Mather vom NASA Goddard Space Flight Center
in Greenbelt (Maryland) und George Smoot von der University of California
in Berkeley (Kalifornien). Manche mögen sich erstaunt die Augen
gerieben haben. Urknall? Ist das nicht so eine abseitige Theorie, die
irgendwo im Niemandsland zwischen nicht bewiesen und umstritten herumgeistert?
Die Urknalltheorie ist nur hinsichtlich einiger Details umstritten.
Die Astrophysiker wissen längst, dass unser Universum einen sehr
heißen Anfang hatte. Bereits 1917 hatte Albert Einstein ein Modell
des Universums vorgelegt, das auf seiner allgemeinen Relativitätstheorie
gründete. Einstein zeigte, dass die Schwerkraft als eine Krümmung
der Raum-Zeit verstanden werden kann, woraus er den Schluss zog, dass
sich das Universum laufend ausdehnt. Unterstützung erhielt Einstein
vom belgischen Astronom und Domherrn Abbé Georges Lemaître
und anderen Astronomen. Was noch fehlte, war ein experimenteller Beweis.
Edwin Powell Hubble und einige seiner Kollegen hatten inzwischen Spektrallinien
ferner Galaxien vermessen und herausgefunden, dass sie um so weiter
in den roten Lichtbereich verschoben waren, je größer ihre
Entfernung war. Hubble deutete diese Rotverschiebung als die Folge einer
Fluchtbewegung der Galaxien. Im März 1929 veröffentlichte
Hubble seine Messergebnisse. Mit dieser Arbeit lieferte er den ersten
experimentell überprüfbaren Hinweis für ein expandierendes
Universum und damit indirekt für die Urknalltheorie.
Der russisch-amerikanische Physiker George Gamov war 1948 der erste,
der aus den Beobachtungen Hubbles den Schluss zog, dass das Universum
ursprünglich sehr klein gewesen sein muss. Aus der Physik wissen
wir, dass rasche Kompression zur Erwärmung, Expansion hingegen
zur Abkühlung führt. Gamov rechnete Hubbles Daten zurück
und kam auf einen Zeitpunkt vor rund 15 Milliarden Jahren, an dem unser
Universum klein und heiß gewesen sein muss. Dem britischen Physiker
Fred Hoyle, dem diese Theorie nicht gefiel, erfand den Spottausdruck
„Big Bang“ (deutsch: „Urknall“), wodurch diese
Theorie erst richtig populär wurde. Ein weiterer Beweis für
die Urknalltheorie kam 1965 mit der Entdeckung der kosmischen Hintergrundstrahlung
durch Arno Penzias und Robert Wilson. Die Arbeiten der beiden diesjährigen
Physik-Nobelpreisträger basieren auf Messungen mit dem 1989 gestarteten
NASA-Satelliten „Cosmic Background Explorer“ (Cobe). Der
Satellit maß Temperaturschwankungen in der Hintergrundstrahlung,
die auf die Entstehung der Galaxien zurückzuführen sind. Der
Durchbruch der Urknalltheorie ist damit endgültig gelungen.
 Jahresübersicht 2006
Jahresübersicht 2006


 Point Venus
Point Venus
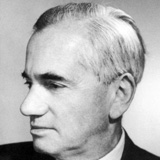

.png)
.png)