Die diesjährigen Gewinner des Nobelpreises für Chemie sind die US-Zellforscher Robert Lefkowitz und Brian Kobilka. Lefkowitz lehrt am Howard Hughes Medical Institute & Duke University Medical Center in Durham und Kobilka an der Stanford University School of Medicine. Beide wurden für ihre Studien über G-Protein-gekoppelte Rezeptoren ausgezeichnet. Was hier unverständlich klingt, hat in der Medizin eine enorme Bedeutung.
Jeder kennt das Phänomen, das schon den Philosophen Aristoteles beeindruckt hatte. Wenn wir uns aufregen, wenn wir Angst haben, wenn wir verliebt sind, kurzum, wenn wir unter Stress stehen, schlägt unser Herz schneller. Das veranlasste Aristoteles zu der irrtümlichen Annahme, das Herz sei der Sitz unserer Gefühle. In Wahrheit sendet das Gehirn bei jeder Form von Stress Signale aus, worauf die Nebennieren, das sind winzige auf unseren Nieren sitzende Drüsen, sofort reagieren. Sie produzieren ein Hormon namens Adrenalin, was übersetzt nichts anders als „bei der Niere“ bedeutet. Das Adrenalin wandert durch das Blut ins Herz, dockt an den so genannten Beta-Rezeptoren an und sorgt dafür, dass das Herz den Turbo anwirft. Dieser Mechanismus ist schon länger bekannt und führte zur Entwicklung der Betablocker, mit denen Hochdruckpatienten behandelt werden. Die Nebenniere produziert weiter Adrenalin, aber das Herz reagiert nicht mehr und bleibt ruhig.
Woher „wissen“ die Betazellen im Herz, dass sie auf Adrenalin reagieren sollen? Wie kommt es, dass jedes der unzähligen Hormone im Körper nur an ganz bestimmten Zellen andocken kann? Der erste, der dieser Frage systematisch nachging, war Robert Lefkowitz, indem er Hormone radioaktiv markierte. Die Sache erwies sich als technisch schwierig, aber in den Siebzigerjahren gelang Lefkowitz und seinem Team die Identifizierung mehrerer Andockstellen, die in der Biologie „Rezeptoren“ genannt werden. Später stieß der junge und ambitionierte Mediziner Brian Kobilka zur Arbeitsgruppe. Der Rezeptor, den die beiden untersuchten, besteht aus einer Eiweißkette, die sich siebenmal von außen nach innen durch die Zellmembran windet. Diese siebenfache Wendel kannte man schon von einem anderen Rezeptor, dem Rhodopsin im Auge. Es stellte sich heraus, dass Hormon- und Lichtrezeptoren genetisch verwandt sind. Es handelt sich dabei um wichtige Erkenntnisse, die man bei der Entwicklung hochwertiger Medikamente umsetzen kann.
Viele Chemienobelpreise der letzten Jahre zeigen einen Trend. Biologie, Biochemie, Genetik und Medizin haben sich so stark angenähert und sind inzwischen so verwachsen, dass nicht mehr genau definiert werden kann, wo die eine Disziplin aufhört und die andere anfängt.
 Jahresübersicht 2012
Jahresübersicht 2012


 Adrenalin
Adrenalin

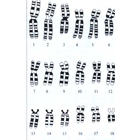
.png)
.png)