Der Generalsekretär der Schwedischen Akademie der Wissenschaften,
Gunnar Öquist, tat sich in diesem Jahr leichter als sonst, als
er die Preisträger des Physiknobelpreises verkündete. Diesmal
ging es nicht um Elementarteilchen, deren Bedeutung nur eine Handvoll
von Quantenphysikern versteht. Die diesjährigen Preisträger
Charles Kao, George Smith und Willard Boyle wurden für die Erfindung
der Lichtleitertechnik und der CCD-Chips ausgezeichnet, Dinge, von denen
physikalisch-technische Normalbürger zumindest schon gehört
haben.
Wenn Licht von Luft in Glas gelangt, wird es geknickt. Dieses Phänomen
nennt man Brechung. Die Stärke der Brechung hängt vom Material
ab. Befindet sich das Licht einmal im Glas, kann es nur noch in einem
steilen Winkel austreten, bei flachen Winkeln wird es wie ein Schwarm
Billardkugeln nach innen reflektiert. Diese Eigenschaft wird bei Lichtleitern
ausgenützt. Ein einmal gefangener Lichtstrahl wird im Inneren weitergeleitet,
wobei ein minimaler Radius des Lichtleiters beim Verbiegen nicht unterschritten
werden darf. Digitale Signale, wie sie heutzutage bei den meisten Datenübertragungen
verwendet werden, werden in einem Lichtleiter per Lichtimpuls übertragen.
Bei dieser Übertragung wird das elektrische Signal im Ausgabegerät
in ein optisches Signal umgewandelt und dann später beim Empfänger
wieder zurück gewandelt. Der Vorteil liegt darin, dass Lichtimpulse
sich weitaus robuster gegenüber Störungen von außen
verhalten als elektrische Signale in Metallkabeln. Der diesjährige
Physiknobelpreis zeigt zudem, welches Ansehen Naturwissenschaftler in
Asien haben. Bereits 1999 kürte die Zeitschrift „Asiaweek“
die fünf wichtigsten Asiaten des 20. Jahrhunderts. Das sind Chinas
Staatschef Deng Xiaoping, Sony-Chef Akio Morita, der Filmemacher Akira
Kurosawa, Indiens großer Politiker Mahatma Gandhi und der Erfinder
der Glasfasertechnik Charles Kao.
George Smith und Willard Boyle sollten 1969, in dem Jahr, in dem die
ersten Mondlandungen stattfanden und das Internet in Betrieb ging, einen
neuartigen Datenspeicher entwickeln. Dabei gelang ihnen die Erfindung
eines elektronischen Bildsensors, wobei sie die Theorie des photoelektrischen
Effekts von Albert Einstein technisch umgesetzt hatten. Der neuartige
Chip hatte eine Oberfläche aus mikroskopisch kleinen metallischen
Feldern, die man heute „Pixel“ nennt. Das Licht schlägt
Elektronen aus den Pixeln, was mit Hilfe der Halbleitertechnik registriert
wird. Diese CCD-Technik („Charge Coupled Device“) wird seit
den Siebzigerjahren in TV-Kameras, seit den Achtzigerjahren in Satelliten
und heute in allen Digitalkameras angewendet.
 Jahresübersicht 2009
Jahresübersicht 2009


 LEDs
LEDs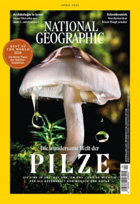
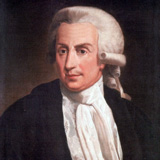

.png)
.png)